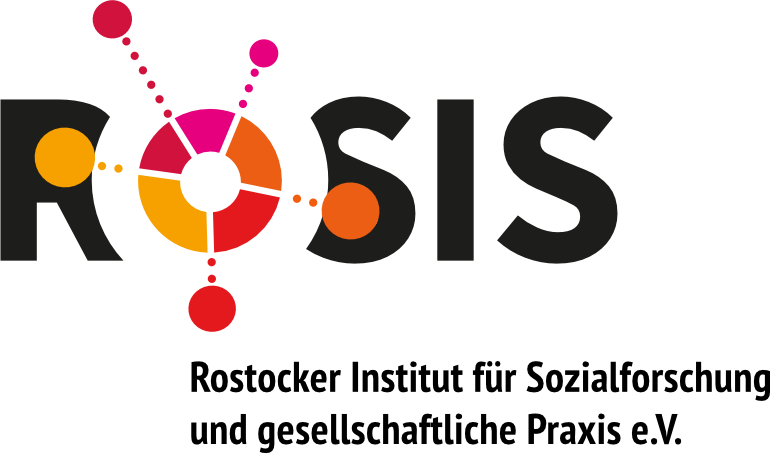BiK – Bleibenlebensweisen in Kleinstädten
Anliegen und Ziele
Ländliche Räume und Kleinstädte sind in den raumbezogenen Sozialwissenschaften und populärwissenschaft-lichen Darstellungen (endlich weiter) in den Fokus gerückt. Mit dieser Aufmerksamkeit einher, geht auch eine Diskussion um die Frage des Gehens oder Bleibens. Für das Phänomen des Bleibens sind neben lebensgeschichtlichen sowie situativ-kontextabhängigen Aspekten insbesondere die sozialen Beziehungen von Bedeutung. Schließlich ist das Bleiben in der Regel keine Einzelentscheidung, sondern wird im Rahmen von Aushandlungsprozessen mit anderen Personen abgeschlossen. Sei es aufgrund von Ratschlägen, aber auch von normativ vermittelten Bildern und Werten über eine vermeintlich richtige Entscheidung. Dieser Aushandlungsprozess bietet die Möglichkeit, Unterstützung zu erfahren, kann aber auch zu Komplikationen führen, wenn bspw. erst Überzeugungsarbeit für eine Alternative geleistet werden muss. An dieser Stelle schließt das Forschungsprojekt „BiK – Bleibenslebens-weisen in Kleinstädten“ an. Fragen wie: Welche Bedeutung haben Unterstützungen und Beratungen bei der Entscheidung der Frage Gehen oder Bleiben? Familienangehörige, Freund:innen und Bekannte sind wichtige Informationsquellen. Es hat sich herausgestellt, dass die Basis der Entscheidungs(be-)gründungen auch erfahrungsbasierte Erzählungen Dritter sind. Ihre Informationen sind häufig relevanter als rationale und logische Begründungen. Welche Rolle haben bestimmte Kommunikationspart-ner:innen, vertraute Personen oder Organisationen, bei der Vermittlung dieser Informationen. Gemeint sind soziale Netzwerke und institutionelle Steuerungspraktiken, die hinsichtlich des Gehens oder Bleibens beraten, sogar organisieren, wie bspw. das Jobcenter oder Rückkehrer:innenagenturen. Es zeigt sich, dass die Struktur der sozialen Netzwerke die Handlungsmöglichkeiten der Bleibenden (mit-)bestimmt.
Vorgehensweise
Hierzu wurden problemzentrierte Gespräche mit vier Bewohnerinnen von Kleinstädten geführt, um bisherige lebensgeschichtliche Relevanzsetzungen des Bleibens und deren Einbettung in soziale Netzwerke zu verstehen. Hinzu kommt eine standardisierte Netzwerkerhebung, die vor dem Hintergrund der Fragestellung spezifische Beziehungen und Beziehungsstrukturen verdeutlicht.
Veröffentlichungen zum Projekt
Rühmling, Melanie (2023): Bleibenslebensweisen in Kleinstädten. Die Rolle der sozialen Beziehungen im Entscheidungsprozess des Bleibens in der Kleinstadt. Cottbus: HochschulCampus KleinstadtForschung (Hrsg.), Working Paper 1.
Link zur PDF-Version des Berichts
Kurzzusammenfassung:
Es sind insbesondere die Eltern, die im Entscheidungsprozess des Bleibens eine wichtige Rolle spielen, und zwar über die unterschiedlichen Lebensphasen hinweg. Grund ist, dass sie es sind, die in jeweiligen Lebensphasen konkrete Unterstützung leisten können und darüber hinaus die Bedürfnisse der Gesprächspartnerinnen genau kennen. In der Phase zwischen Schulabschluss und Ausbildung können sie darüber hinaus als Push-Faktoren gelten, ohne dass die Beziehung zwischen ihnen konfliktbehaftet ist.
Zudem ist der:die Partner:in relevant. Innerhalb der Partnerschaft wird sich abgestimmt, verhandelt, sich geeinigt und es werden Verantwortung und Konsequenzen gemeinsam getragen.
Auffällig ist, dass es vor allem die Eltern und der:die Partner:in sind, die die Gesprächspartnerin als passive Akteurin im Entscheidungsprozess positionieren, also die Entscheidungsfindung für die Gesprächspartnerin übernehmen.
Wenn das Bleiben in der Kleinstadt abhängig ist vom bisherigen Lebenslauf und den sozialen Beziehungen, aber auch von aktuellen Bedürfnissen, ist dieser Dreiklang auch auf weitere relevante Personen wie die Eltern oder den:die Partner:in übertragbar und strahlt somit wiederum auf die Bleibensintention der Gesprächspartnerin ab. Für die Entscheidung, vor Ort zu bleiben, ist es also zuträglich, wenn Personen aus dem sozialen
Netzwerk selbst auch in der Kleinstadt aufgewachsen sind. Schließlich gehen damit vielschichtige soziale und räumliche Beziehungen einher, die wiederum die Gesprächspartnerinnen einbeziehen.
Die Atmosphäre vor Ort, die von anderen Bewohner:innen geprägt wird, trägt wesentlich zum Bleiben in der Kleinstadt bei. Allein ein scheinbar lapidares Grüßen, ein „Jeder-kennt- jeden“-Gefühl oder das Wissen um soziale Zusammenhänge intensiviert eine Ortsbindung, die wiederum als Symbol des eigenen Verortens im relevanten Raum genutzt wird. Diese hohe Identifikation durch die anderen Bewohner:innen wirkt sich positiv auf die Entscheidung, in der Kleinstadt zu bleiben, aus.
Ergebnis IV: Die Entscheidung, zu bleiben, misst sich nicht allein an vorhandenen Arbeitsplätzen
Auffällig ist, dass die Entscheidung, in der Kleinstadt zu bleiben, sehr selten auf einer konkreten Problemlage basiert. Der Abwägungsprozess wird nicht nur anhand ökonomischer und rein rational getroffener Teilentscheidungen dargestellt. Vielmehr wird von weichen Standortfaktoren, emotionalen Gründen und einem diffusen Gefühl von „Zufall“ und „Glück“ gesprochen.
Auch wenn die sozialen Beziehungen auf einer manifesten Ebene von den Gesprächspartnerinnen nicht als ausschlaggebender Grund genannt werden, ist doch sehr auffällig, dass sie wesentlich zum Bleiben in der Kleinstadt beitragen. Es ist daher wichtig, nicht nur die Bedürfnisse einzelner Personen zu fokussieren, sondern das ganze System sozialer Beziehungen in den Blick zu nehmen, wenn es um kleinstädtische Lebensverhältnisse geht.
ZEITRAUM:
02/2022–07/2022
PROJEKTVERANTWORTLICHE:
AUFTRAGGEBER*IN:
Hochschulcampus Kleinstadtforschung
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg